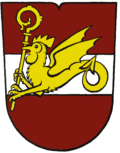Basilisk (Wappentier)
(Wappenschild der Herren von Bremen, Rothenburger Geschlecht; nach Ströhl, 1910)
Der Basilisk![]() steht in der Heraldik als Wappentier in der Reihe der gemeinen Figuren. Der Basilisk wird auch als Hahndrache [1] bezeichnet.
steht in der Heraldik als Wappentier in der Reihe der gemeinen Figuren. Der Basilisk wird auch als Hahndrache [1] bezeichnet.
Abgrenzung
Der Basilisk wird in vielen Blasonierungen und Quellen der Heraldik mit einer Unzahl von anderen Wappentieren oder heraldischen Fabelmotiven wie Amphisbaena, Lindwurm, Wyvern, Harpyie oder Drache verwechselt, obwohl seine Erscheinung in der Heraldik – im Gegensatz zu seiner Erscheinung in der Mythologie und in der bildenden Kunst – relativ eindeutig und nicht fließend ist: Wie auch immer ihr Körper gestaltet ist, die Basiliskenfigur besitzt einen Hahnenkopf! Wenn in der Heraldik eine Wappenfigur keinen Hahnenkopf besitzt, ist sie kein Basilisk, selbst wenn sie als Basilisk blasoniert wurde. Diese heraldische Regel gilt für die europäische Wappenkultur, nicht für neuere Wappendarstellungen außerhalb Europas, wo man den Basilisk manchmal auch mit einem anderen Tierkopf im Wappen darstellt (siehe z. B. das Wappen von Kasan). Ohne Bedeutung ist diese Typisierung auch für Basiliskendarstellungen außerhalb der Heraldik (dort kann ein Basiliskenkopf auch drachenkopfartig oder anders gestaltet sein).
Die Unterscheidung der angloamerikanischen Heraldik zwischen
- Cockatrice (Hahndrache mit Flügel, tötet durch Atem, pfeilspitzförmiger Schwanz) und
- Amphisien Cockatrice bzw. Basilisk (Hahndrache mit/ohne Flügel, tötet durch seinen Blick, Schwanz mit zusätzlichem Schlangen- oder Drachenkopf)
ist der kulturellen Rezeption geschuldet und auf dem europäischen Kontinent nicht verbreitet.
Darstellung und Blason
In der Wappenkunde ist der Basilisk eine Mischung aus Hahn, Schlange und Drache. Die heraldische Darstellung erfolgt stets im Profil, gewöhnlich nach rechts (heraldisch) sehend. Sie beschränkt sich auf ein drachenähnliches, zweibeiniges und geflügeltes Tier mit Hahnenkopf und Schlangenschwanz (und optional einer Krone für das Attribut "König der Schlangen").
Der Hahnenkopf und die Vorderfüße sind häufig dem Adler angelehnt, die Flügel und der Körper dem Drachen. Das Schwanzende wird entweder pfeilförmig (wie bei einem Drachen) dargestellt oder als zweiter Kopf (Drachen-, Schlangen-, Totenkopf oder ähnliches). Die Bewaffnung (Krallen, Schnabel, Zunge und Vogelbeine) wird oft andersfarbig tingiert.
„Eine Abart des Drachen ist der Basilisk (Tafel XXII. Figur 29.), altdeutsch: Unk, ein Drache mit Hahnenkopf wie z. B. im Wappen der Edlen von Kuepach in Bayern. Unseres Erachtens muss das Wappenthier der von Wurmbrand ebenfalls als Basilisk bezeichnet werden.“
Verbreitung
Eine frühe Basilisk-Wappenfigur (14. Jhr.) findet sich in einem nicht identifizierten Wappen in der Züricher Wappenrolle. Als gemeine Figur, Wappentier oder Schildträger wird der Basilisk eher selten in Wappen gefunden. Dennoch besitzt er als zeitweiser Schildträger des Wappens der Stadt Basel![]() (seit dem 15. Jahrhundert) einen gewissen Bekanntheitsgrad. Ein Taler von 1741 zeigt im Avers (auf der Vorderseite) die Ansicht der Stadt Basel und darüber die Wappen der acht Vogteien. Im Revers einen Basilisk mit dem Wappen und der Randschrift CONCORDIA ... [5]
(seit dem 15. Jahrhundert) einen gewissen Bekanntheitsgrad. Ein Taler von 1741 zeigt im Avers (auf der Vorderseite) die Ansicht der Stadt Basel und darüber die Wappen der acht Vogteien. Im Revers einen Basilisk mit dem Wappen und der Randschrift CONCORDIA ... [5]
Die Darstellung von Basilisken verbindet man mit den Wappen der Familien von Kuepach, von Wurmbrand, von Breidbach, von Kesselstatt und anderen, obwohl diese ursprünglich wohl keine „echten“ Hahndrachen führten, sondern andere Fabeltiere. Je nach Quelle variieren hier die Angaben. Daß die Darstellung zwischen Basilisk und Drache/Lindwurm in der Geschichte und Interpretation eines Familienwappens schwankt, kann stellvertretend an dem Wappen der Familie Nugent von Westmeath gezeigt werden (siehe nachstehende Abbildungen):
| Aus Hahndrache wird manchmal Drache (und umgedreht) Wappen der Familie Nugent | ||
| Basilisk | Drache/Lindwurm | |
Nur bei wenigen Familien gibt keinen Zweifel, dass sie schon immer oder aber seit einem bestimmbaren und belegbaren Zeitpunkt einen Basilisken im Wappen führen/führten. Hierzu zählen zum Beispiel:
- Heusinger (Führung um 1563, bürgerliche Familie aus Regensburg)
- von Chlumecky (seit 1827/1844 Wappen mit Basilisk, böhmisch-mährisches Adelsgeschlecht)
- Janka (Wappenstiftung 2010, Bürger-/Handwerkerfamilie aus Mähren)
Bedeutung
Außerhalb der Heraldik symbolisiert der Basilisk unter anderem:
- den Tod
 , die Häresie
, die Häresie , den Teufel
, den Teufel , die Sünde
, die Sünde oder den Antichrist
oder den Antichrist (z. B. in der katholischen Symbolik des 16./17. Jahrhunderts: Basilisk = König der Schlangen = Satan = Reformation)
(z. B. in der katholischen Symbolik des 16./17. Jahrhunderts: Basilisk = König der Schlangen = Satan = Reformation) - Teilweise fungiert der Basilisk als Symbol für eine der Todsünden (gleichsetzung mit Wollust, aber auch mit Neid und Hochmut).
- Pest und Tod (der Atem eines Basilisken ist angeblich "tödlich giftig")
- Vertreibung (in Anlehnung an die Rolle der Schlange, bei der Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies)
- König der Schlangen
- In der Alchemie galt die Asche des Basilisken als Mittel gegen andere giftige Tiere; das Fabelwesen selber wurde mit dem Stein der Weisen
 gleichgesetzt.
gleichgesetzt. - Die Krankheit Syphilis wurde teilweise „Basiliskengift“ genannt.
Beispiele
Basilisk-Fabelwappen des römischen Königs Numa Pompilius (715–672 v. Chr.).[6]
Wappen von Itzgrund[7]
Wappen von Kasan[8]
Wappen von Ried im Oberinntal[9]
Wappen des Bezirks Porrentruy
 , Kanton Jura, Schweiz
, Kanton Jura, Schweiz
Wappen von Benátky nad Jizerou (deutsch: Benatek), Tschechien.[10]Das kleine Wappen mit dem Basilisk führte Jan z Kunvaldu, in den Jahren 1437–1510 Gutsherr des Ortes (vgl. im Siebmacher: Wražda Von Kunwald (Vražda))
Wappen des Dorfes Eppisburg
 vor seiner Eingemeindung.
vor seiner Eingemeindung.
- Basilisken, Drachen oder Wyvern, die ohne „Hahnenkopf“ aufgerissen wurden ...
Siehe zur Kontroverse „Basilisk“ oder „Drachen“ den Beitrag: Wappen von Kesselstatt
Wappen von Wartenberg (Oberbayern)[11]
Wappen von Rheinbreitbach[12]
Wappenschild von Sankt Johann (bei Mayen)
 : Silber mit rotem Basilisk[13]
: Silber mit rotem Basilisk[13]
Siehe auch
Weblinks
 Commons: Basilisken in der Heraldik – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Commons: Basilisken in der Heraldik – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien- Infos und Links zum Basilisken
- Verwendung eines heraldischen Basilisken beim Anfertigen einer Fahne
Literatur
Thomas Hofmeier: Basels Ungeheuer. Eine kleine Basiliskenkunde. (Basiliskologie). secretBasel2. Berlin & Basel 2013, ISBN 978-3-939176-23-7 (5. Auflage 2021).
Einzelnachweis
- ↑ Die Hauptstücke der Wappenwissenschaft, Band 1, Christian Samuel Theodor Bernd, Verlag Bei dem Verfasser und bei Ed. Weber, Bonn 1841
- ↑ J. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch, Einleitungsband, Abteilung B: Grundsätze der Wappenkunst verbunden mit einem Handbuch der heraldischen Terminologie (Maximilian Gritzner). Nürnberg: Bauer & Raspe, 1889/1890. S. 99. Tafel 22. Figur 29. Reprint on Demand. Universtitäts- und Landesbibliothek Tirol. 2009. ISBN 3-226-00671-1.
- ↑ Das Wappen stammt aus Konrad Grünenbergs Wappenbuch und bezieht sich auf die byzantische Herscherdynastie der Komnenen bzw. auf das Kaiserreich von Trapezunt
 am Schwarzen Meer (1204 bis 1461). Wörtlich heißt es bei Grünenberg: „Der Kaiser von Trappesod stößt an Kriechen und an das Kaisertum von Athen; hat yetzo der türkisch Kaiser gewunnen und den Kaiser geköpft.“
am Schwarzen Meer (1204 bis 1461). Wörtlich heißt es bei Grünenberg: „Der Kaiser von Trappesod stößt an Kriechen und an das Kaisertum von Athen; hat yetzo der türkisch Kaiser gewunnen und den Kaiser geköpft.“
- ↑ Blason: Gespalten von Silber und Blau, vorn drei silbern-besamte blaue Veilchenblüten pfahlweise, hinten ein nach links gekehrter silberner Stulpenstiefel, pfahlweise durchbohrt von einem gestürzten silbernen Pfeil. Auf dem blau-silbern bewulsteten Helm mit blau-silbernen Decken ein golden-bewehrter silberner Basilisk mit gespaltener roter Zunge, pfeilspitzförmigem, mit goldenen Zähnen besetztem Schwanz und blauen Drachenflügeln, mit der rechten Kralle greifend ein geschlossenes blaues Buch mit silbernem Schnitt, belegt mit einer silbernen Veilchenblüte.
- ↑ Das der Stadt Nürnberg gehörige Isaak von Peyer'sche Münz- u. Medaillen-Cabinet, J. R. Erbstein, H. Albert Erbstein, Nürnberg 1863, Seite 11
- ↑ Blason: In Gold ein grüner Basilisk, mit rotem Schnabel, ebensolchem Kamm und Beinen und goldenen Flügeln, einen schwarzen Skorpion vertilgend.
- ↑ Blason: Unter von Rot und Silber im Zickzackschnitt geviertem Schildhaupt in Gold ein schwarz gekrönter und bewehrter roter Basilisk, der seine linke Kralle auf einen von Silber und Rot gevierten Schild stützt.
Bedeutung: Der Basilisk ist aus dem Wappen von Kloster Banz entnommen, das ein bedeutender Grundherr und Herrschaftsinhaber im Gemeindegebiet war. - ↑ Blason: In Silber steht auf einem grünen Schildfuß ein goldgekrönter, goldbewehrter, rotflügliger schwarzer Basilisk mit roter Schwanzspitze.
Ursprünglich ähnelte der Basilisk der Tatarenstadt Kasan einem Adler mit Drachenschwanz, aus dessen Schnabel eine Flamme lodert. Geschichte: Das erste offizielle Wappen von Kazan wurde bereits im 16. Jahrhundert als Siegel geführt, 1721 als Wappenfigur bestätigt und am 18. Oktober 1781 genehmigt. Modernisiert wurde das Wappen im Jahr 2005. Im Jahr 1926 gab es in diesem Kulturkreis ein Verbot der Heraldik, wovon auch das Wappen von Kasan betroffen war, das auch als Wappenschild auf dem rechten Flügel des alten Zarenadlers zu sehen war. In dem Kulturraum symbolisieren Basilisken und Drachen Stärke, Weisheit und Unbesiegbarkeit, auch die Erde, das Leben und den Reichtum. (Quelle: Volborth: Fabelwesen der Heraldik. 1996. Sowie: Kasan )
)
- ↑ „Im 13. und 14. Jh. diente das Schloß dem Adelsgeschlecht der Herren von Ried als ständiger Wohnsitz. Die Herren von Ried besaßen einen Basilisken (Fabeltier) in ihrem Wappen. Dieser ziert heute das Gemeindewappen von Ried im Oberinntal.“ Verleihung am 27. Nov. 1973. Blason: In Schwarz ein goldener Basilisk. Quelle: Gemeinde Ried
- ↑ Benátky nad Jizerou: Wappenbeschreibung, (tschechisch)
- ↑ Blason: In Rot ein geflügelter goldener Drache mit silberner Pfeilzunge und Stachelschwanz.
- ↑ Blason: Geteilt von Grün und Rot; oben ein silberner Schrägwellenbalken; unten ein stehender, goldbewehrter silberner Drache (Basilisk) mit ausgebreiteten Flügeln, darin vorn ein kleiner roter Schild mit drei, 2:1 gestellten silbernen Schildchen, hinten ebenfalls ein kleiner roter Schild mit zwei gekreuzten silbernen Berghämmerchen.
- ↑ Das Wappen der Ortsgemeinde St. Johann wurde am 13. Mai 1949 vom Regierungspräsident Koblenz verliehen. Es entspricht dem Familienwappen der Herrschaftsfamilie v. Breidbach, deren Namensträger von 1473 bis 1796 Schloß Bürresheim in der Gemarkung von St. Johann bewohnten.