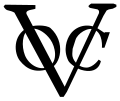Siegel
Das Siegel (von lat. sigillum, Bildchen) ist eine Form der Beglaubigung von Urkunden oder Sicherstellung (Verschluss) der Unversehrtheit von Gegenständen oder Behältnissen (Briefumschlag, Tür) mithilfe eines Siegelstempels oder, sphragistisch (siegelkundlich) korrekt, eines Typars, der in eine weiche, erhärtende Masse (Siegelklumpen aus Siegellack, Wachs, früher Ton etc.) gedrückt wird. Oft wird zwischen „Siegel“ als Abdruck und „Siegelstempel“ als Prägewerkzeug begrifflich nicht unterschieden. Für „Siegelstempel“ kann auch der aus dem Slawischen stammende Begriff Petschaft (n. oder f.) benutzt werden.
Rechtliches
Rechtlich ist jedes dienstliche „Siegel“ einzigartig (gegenüber beliebig herstellbaren „Stempeln“ – es verhält sich hier ähnlich wie bei dem Unterschied zwischen Fahne und Flagge). Wer es führen darf, ist eigens geregelt. Der Siegelbruch, das unberechtigte Zerstören eines Siegels, das durch eine Behörde, einen Amtsträger oder sonst dienstlich angebracht wurde, ist in Deutschland strafbar (§ 136 Abs. 2 StGB). Ein unbrauchbar gewordener Siegelstempel einer Behörde darf nur unter Hinzuziehung eines Zeugen und mit einem entsprechenden Protokoll vernichtet werden.
Historisches

Die frühesten Stempelsiegel sind im Vorderen Orient nicht vor der Tell Halaf-Zeit nachzuweisen. Rollsiegel sind erstmals in Sumer zwischen 3200 und 3100 v. Chr. in der Uruk IV-Schicht belegt. Dies sind kleine Steinzylinder aus Onyx, Lapislazuli, Achat oder anderen Stoffen, in die Figuren und Inschriften eingraviert wurden. Die Größe schwankt zwischen 0,15 und 10 Zentimetern. Durch das Abrollen des Zylinders in eine weiche Masse (zum Beispiel Ton) entsteht der charakteristische Siegelabdruck. Etwa zeitgleich tauchten zwischen 1600 v. Chr. und 1500 v. Chr. im Alten Ägypten, in Ugarit sowie bei den Hethitern die Siegelringe auf, wobei der Siegelring in Mesopotamien nicht in Gebrauch war.

Solche Siegelabdrücke (in Ton) finden sich außer bei den Sumerern, Assyrern und Babyloniern (Rollsiegel), später auch bei Griechen und Römern, von denen sie die Herrscher des Frühmittelalters übernahmen. Siegelführend waren zunächst Einzelpersönlichkeiten, später auch Körperschaften. Kaisersiegel finden sich in Byzanz seit dem 6. Jahrhundert, Papstsiegel seit dem 9. Jahrhundert. Im frühen und hohen Mittelalter siegelten Kaiser und Könige sowie Angehörige des Adels und der hohen Geistlichkeit, denen die Bürger seit dem 13. Jahrhundert folgten. Siegel geistlicher Korporationen finden sich seit dem 11. Jahrhundert, Städtesiegel seit dem Anfang des 12. Jahrhunderts (Trier 1113, Köln 1149).
Später gebrauchte man Metallsiegel („Bullen“) (aus Gold und Silber bei byzantinischen Kaisern, aus Blei bei Päpsten). Später siegelte man
- mit rotem Wachs: (Kaiser, Könige), die das Recht hierzu auch anderen Fürsten verliehen, grundsätzlich nur bei (staatsrechtlichen) „Souveränen“;
- mit grünem Wachs: geistliche Stifter und Klöster;
- mit weißem Wachs: Freie Reichsstädte;
- mit schwarzem Wachs: der Patriarch von Jerusalem und die Großmeister der geistlichen Ritterorden; heute noch gel. bei Trauerbriefen.
Später traten die Oblaten (runde weiße Papierflächen) an die Stelle des Wachses und im 16. Jahrhundert der bekannte Siegellack, der hitzefester als Wachs ist. Seit dem 11. Jahrhundert wurde es üblich, bildliche Darstellungen (wie Wappen) in die Siegel einzubeziehen.
Um Siegelmissbrauch zu verhüten, wurden die Siegelstempel im Mittelalter sorgfältig aufbewahrt. Die großen Siegel der Herrscher waren hohen Beamten anvertraut. Später wurde das Amt des Siegelbewahrers zum bloßen Titel (zum Beispiel Lordsiegelbewahrer in England).
Formen von Siegeln
Mit einem Griff versehen, wird ein Siegel Petschaft genannt, gebräuchlicher und älter sind Siegelringe. Das Siegel kann auf die Urkunde gedrückt sein oder an einer Schnur oder einem Pergamentstreifen befestigt sein.
Andere Ausführungsformen mit Siegel-Funktion sind Aufkleber wie das Pfandsiegel (umgangssprachlich auch Kuckuck genannt), die an Kfz-Kennzeichenschildern angebrachte Zulassung-Prüfplakette, Plomben an Verschlüssen und Geräten, Sicherungsstempel an Meßgeräten.
Beispiele verschiedenartiger Siegel
Siegel Kaiser Heinrichs III.
Siegel des Lobengula
Siegel der VOC
Siegel der Jauch
Siegel der Zimmerer
Siegel der Republik Formosa, 1895: 民主國之寶印
Inkan aus Japan
Siegel des Kaiserin-Friedrich-Gymnasiums
Siegel der Universität zu Köln
Siegel auf Adelsbrief Kaiser Karls VI.
Rückseite einer Bulle Kaiser Friedrichs II. von 1246
Siegel des Kayser Steinbruch, ab 1617
Siegelstempel des türkischen Präsidentenamtes
Großes Bonner Stadtsiegel
Siegel im ostasiatischen Kulturkreis
Die chinesische Bezeichnung für Siegel lautet yín (印) oder túzhāng (图章). Die japanische Bezeichnung für Siegel ist Inkan (印鑑) oder Hanko (判子). Diese Siegel werden geschäftlich und privat eingesetzt und sind oft wichtiger als die eigenhändige Unterschrift. In manchen Fällen wird gar nur das Siegel als Beglaubigung akzeptiert.
Spezielle Siegel
- Rollsiegel – ägyptische Vorläufer des Stempelsiegels
- Rotsiegel - Siegel aus rotem Wachs waren im Heiligen Römischen Reich ein Privileg, das dem Kaiser, den Kardinälen und nur vom Kaiser privilegierten Instanzen des Reiches vorbehalten war (Rotsiegelprivileg)
- Dienstsiegel – Amtliche Siegel zur rechtsverbindlichen Kennzeichnung von Dokumenten oder zum Verschluss
- Siegelring – im Fingerring untergebrachter Siegelstempel
- Fischerring – der päpstliche Siegelring
Verwandte Themen
- Sphragis (Siegel) – verschlüsselte Hinweise auf den Autor in einem literarischen Werk
- manu propria – die eigenhändige Unterschrift eines Herrschers
- Buch mit sieben Siegeln – die Symbole in der Bibel
- Tibetische Siegel
Literatur
- Handbücher
- Andrea Stieldorf: Siegelkunde. In: Hahnsche Historischen Hilfswissenschaften. Band 1. Hannover 2004, ISBN 3-7752-6132-X.
- Erich Kittel: Siegel. In: Bibliothek für Kunst- und Antiquitätenfreunde. Band 11. Braunschweig 1970 (mit umfangreicher Bibliographie S. 468–509).
- Wilhelm Ewald: Siegelkunde. In: Handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte. Band 4. München-Berlin 1914 (Nachdruck München 1978).
- Egon von Berchem: Siegel. In: Bibliothek für Kunst- und Antiquitätensammler. Band 11. Berlin 1923.
- Michel Pastoureau: Les sceaux. In: Typologie des sources du moyen âge occidental. Band 36, 1981, ISSN 0775-3381 (frz.).
- Toni Diederich: Rheinische Städtesiegel. In: Jahrbuch Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e. V. Band 1984/1985. Neuss 1984/1985, ISBN 3-88094-481-4, S. 25–149.
- Tafelwerke
- Otto Posse: Die Siegel der deutschen Könige und Kaiser von 751–1913. Dresden 1909–1913 (auf Wikisource – 5 Bände: 1. 751–1347, 2. 1347–1493, 3. 1493–1711, 4. 1711–1806 1871–1913, 5. Textband).
- Friedrich Philippi: Siegel. In: Urkunden und Siegel in Nachbildungen. Band 4. Berlin 1914.
- Wilhelm Ewald: Rheinische Siegel. In: Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde. Band 27. Bonn 1906–1941 (6 Bände).
- Aldo Martini: Die Goldsiegelsammlung aus dem Geheimarchiv des Vatikans: Katalog der Ausstellung in der Bayerischen Landesbank München. 1989 (ohne Jahr und Ort).
- Pietro Sella: I sigilli dell'Archivio Segreto Vaticano. In: Inventari dell'Archivio Segreto Vaticano: Bände 1–3. Band 1. Vatikan 1937, 1946, 1964 (ital., 3 Bände).
- Hilfsmittel und Bibliographie
- Vocabulaire international de la sigillographie. In: Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Sussidi. Band 3. Rom 1990 (frz.).
- Eckart Henning, Gabriele Jochums: Bibliographie zur Sphragistik. Schrifttum Deutschlands, Österreichs und der Schweiz bis 1990. In: Bibliographie der Historischen Hilfswissenschaften. Band 2. Köln 1995, ISBN 3-412-08695-9.
Weblinks
- Glossar der Sphragistik
- Virtual Library Geschichtliche Hilfswissenschaften – Sektion Siegelkunde/Sphragistik
- Peter Weiß: Frühe Siegelurkunden in Schwaben (10.-12. Jahrhundert). Diss. Universität Konstanz, 1995
- Marie-Luise Heckmann:Einführung und Siegelabbildungen
- Marie-Luise Heckmann:Texte zur Authentizität mittelalterlicher Beglaubigungsmittel
Quelle
Dieser Artikel basiert auf dem Beitrag „Siegel“ aus der freien Enzyklopädie Wikipedia in der Version vom 15. April 2010 (Permanentlink: [1]). Der Originaltext steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation bzw. unter CC-by-sa 3.0 oder einer adäquaten neueren Lizenz. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Autoren verfügbar.